Individuelle Mobilität sichern und gleichzeitig die Klimabilanz im Straßenverkehr verbessen – das gelingt am besten mit der Elektromobilität. 15 Millionen Elektroautos sollen im Jahr 2030 in Deutschland unterwegs sein und Deutschland damit zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Diese Zielmarke folgt keinen planwirtschaftlichen Vorgaben; vielmehr basiert Mobilität auf individuellen Entscheidungen von Unternehmen und Bürgern. Das BMDV verfolgt daher einen technologieoffenen Ansatz, damit neben der Elektromobilität auch andere Optionen zum Klimaschutz beitragen können. Im Pkw-Bereich haben die Hersteller bereits eine breite Modellvielfalt mit dem Schwerpunkt Elektromobilität entwickelt. Voraussetzung für die Kundenakzeptanz von Elektroautos ist neben einem attraktiven Angebot an Fahrzeugen und wettbewerbsfähigen Preisen insbesondere der Aufbau einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Hierzu leistet das BMDV mit dem „Deutschlandnetz“ einen wichtigen Beitrag.
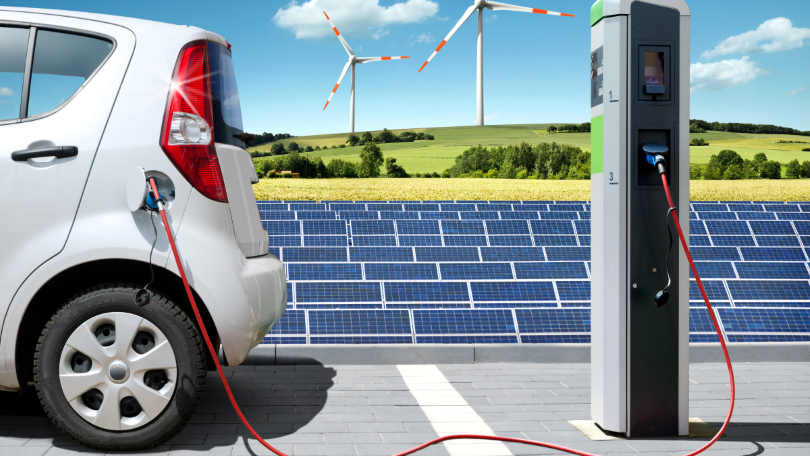
Quelle: Adobe Stock / Petair
Markthochlauf Elektromobilität
Das BMDV verfolgt den strategischen Ansatz, den Markt für alternative Antriebe und Kraftstoffe zu initiieren und den Hochlauf zu begleiten. Die Ausrichtung dabei ist technologieoffen, Elektromobilität gilt als Schlüsseltechnologie. Zur Begleitung der Marktphasen (Vorbereitung, Hochlauf, Massenmarkt) sind diverse Programme und Maßnahmen initiiert und etabliert worden. Auf der Förderseite reichen diese von Forschungs- und Entwicklungsförderung über Investitionsförderprogramme für Fahrzeuge und Infrastruktur bis hin zu Prämien beim Fahrzeugkauf. Flankierend wurden auch regulative und fiskalische Maßnahmen ergriffen. Dies hat dazu beigetragen, dass sich der Markt für Elektro-Pkw sehr dynamisch entwickelt. Den aktuellen Stand der Marktentwicklung können Sie hier einsehen.
Ausbau der Ladeinfrastruktur
Voraussetzung für die Akzeptanz der Elektromobilität ist der vorauslaufende Ausbau einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Mit den bereits erreichten Ausbauzahlen liegt Deutschland im EU-weiten Spitzenfeld. Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter zu beschleunigen, hat das BMDV mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur II gemeinsam mit den beteiligten Ressorts, den Ländern und Kommunen sowie der Industrie Handlungsfelder identifiziert und eine Gesamtstrategie entwickelt.
Die wichtigsten Handlungsfelder des Masterplans Ladeinfrastruktur II im Überblick:
- Ladeinfrastrukturaufbau vereinfachen und beschleunigen
- Ladeinfrastruktur und Stromsystem integrieren
- Ladeinfrastruktur durch Digitalisierung verbessern
- Kommunen als Schlüsselakteure befähigen und stärker einbinden
- Ladeinfrastruktur für E-Lkw initiieren
Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur
Für alle, die über keine Möglichkeit zum Laden zu Hause oder beim Arbeitgeber verfügen sowie für Fahrten auf der Mittel- und Langstrecke, muss ausreichend Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum geschaffen werden. Hierfür hat das BMDV passende Maßnahmen wie das Programm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ und die Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor Ort“ umgesetzt. Von den öffentlich zugänglichen Ladepunkten in Deutschland wurde rund ein Viertel mit Förderungen des BMDV errichtet.
Das Deutschlandnetz
Mit dem Deutschlandnetz schafft das BMDV 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos. Sie entstehen in Regionen, in Städten und an unbewirtschafteten Autobahn-Rastanlagen, die bislang weiße Flecken auf der Ladelandkarte waren. Private Unternehmen bauen die mehr als 1.000 Standorte des Deutschlandnetzes im Auftrag des BMDV. Rund 900 Standorte entstehen im urbanen und ländlichen Raum, 200 direkt an den Autobahnen. Wenn im Jahr 2026 alle Standorte fertiggestellt sind, finden Autofahrerinnen und Autofahrer deutschlandweit schnell und ohne Umwege die nächste Schnellladesäule. Insgesamt investiert das BMDV rund 2,3 Milliarden Euro in die Errichtung und den Betrieb der Standorte.
Nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur
Wer privat ein Elektroauto fährt, lädt überwiegend zu Hause oder beim Arbeitgeber. Im gewerblichen Bereich werden vornehmlich Ladepunkte auf dem Betriebsgelände genutzt. Im nicht-öffentlichen Bereichen werden bis zu 80 Prozent der Ladevorgänge durchgeführt. Aus diesem Grund hat das BMDV Förderprogramme aufgelegt, um hier den Aufbau von Lademöglichkeiten zu unterstützen. So förderte das BMDV über die „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur an Wohngebäuden“ den Kauf und die Installation von privaten Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden. Durch die Förderung wurden insgesamt rund 690.000 private Wallboxen installiert. Mit dem Programm „Solarstrom für Elektroautos“ wurde ein Gesamtpaket zur Eigenstromnutzung bestehend aus Ladestation, Photovoltaikanlage und Speicher gefördert. Der überwältigende Zuspruch zu diesem Förderprogramm zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, in die Elektromobilität zu investieren und auf eine klimafreundliche Mobilität umzusteigen. Über das „Solarstrom“-Programm kann das BMDV rund 33.000 Haushalte bei diesem Umstieg unterstützen.
Auch im gewerblichen Bereich unterstützt das BMDV Unternehmen bei der Umstellung ihrer Flotten auf Elektromobilität. Hierzu wurde im Herbst 2023 ein „Förderprogramm zur Errichtung von nicht-öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen“ veröffentlicht.
Erneuerbare Kraftstoffe
Das BMDV hat sich immer dafür eingesetzt, dass HVO (hydrotreated vegetable oil) und E-Diesel zukünftig auch in Reinform im Straßenverkehr vertankt werden können. Die entsprechende Regulierung (10. BImSchV) wurde angepasst und ist im April 2024 in Kraft getreten.